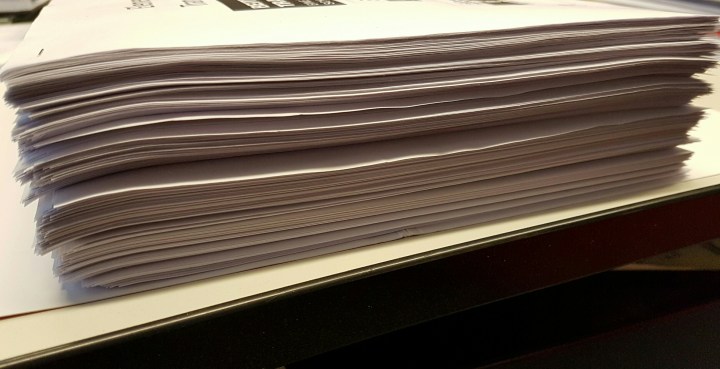Man habe keine große Dankbarkeit erwartet, aber etwas mehr spürbaren Respekt für all das, was man ihnen an Lebenszeit, Mühe und Aufwand geschenkt hat. So ist es immer wieder zu hören. Undank ist der Welten Lohn und nicht nur Grund zum Kummer unzähliger Eltern aller Menschheitsgenerationen.
Menschen wollen Kinder „haben“ (!) und müssen lernen, dass die anfänglichen Nesthocker ihnen schließlich entfliehen. Sie wurden nicht gefragt, bevor sie in die Welt gesetzt wurden, und sie fragen auch nicht, wann und wie sie aus der unmittelbaren Lebensumwelt der Eltern wieder verschwinden und nur noch auf Besuch auftauchen. Wenn alles gut bleibt in der Familie.
Das Muster gilt überall. Flüchtlingshelfer sind traurig, dass die Geflüchteten, nachdem man sie doch mit nervenzehrenden Anstrengungen an Ort und Stelle integriert hat, auf Nimmerwiedersehen weiterziehen – vielleicht von WhatsApp-Grüßen ein Mal im Jahr abgesehen. Warum sollte ein Mensch, der Heimat, Familie und Freunde zurückließ, nun an irgendwelchen zufälligen Gehilfen am ebenso zufälligen einstweiligen Asylort längerfristig klebenbleiben?
Also bitte keine seelische Unzucht mit Abhängigen! Wir reden von einem undankbaren Job, wenn dabei nichts herauskommt. Wenn der, dem wir auf seinem Lebensweg weitergeholfen haben, ohne uns weitergehen kann, ist das doch der schönste Dank.
Dass einem manchmal der, dem man nur zwei Mal Zukunftsweisendes vermitteln konnte, mehr Dankbarkeit zeigt als die, denen man zahllose Abende für Nachhilfe aller Art opferte, ist auch normal. Schließlich erweckt man durch eine solche freiwillig gewählte Freizeitgestaltung den Eindruck, man habe sowieso nichts Besseres zu tun und sei ihnen für ihre schlichte Anwesenheit dankbar. 😉
Unser kluger junger syrischer #refugee -Arzt sagt es so: Das Gute, das man tut, bekommt man von anderen (!) wieder zurück. – Es ist kein Tauschgeschäft. Das hängt schon mit zeitverzögerter Wahrnehmung von Hilfseffekten ab, von denen man selbst profitiert.
Ich bin zum Beispiel von Haus aus etwas schwer von Begriff, meine erste Grundschul-Note war ein Mond, nur die drittbeste von vier Bewertungen. Trotzdem war ich in den darauffolgenden Jahren ein Spitzenschüler. Ohne die – geschätzt – zweitausend Stunden Schulbegleitung, die meine Mutter in mich investierte, hätte ich das nie geschafft. Damals hielt ich das für normal und mich einfach für einen guten Schüler. 😊